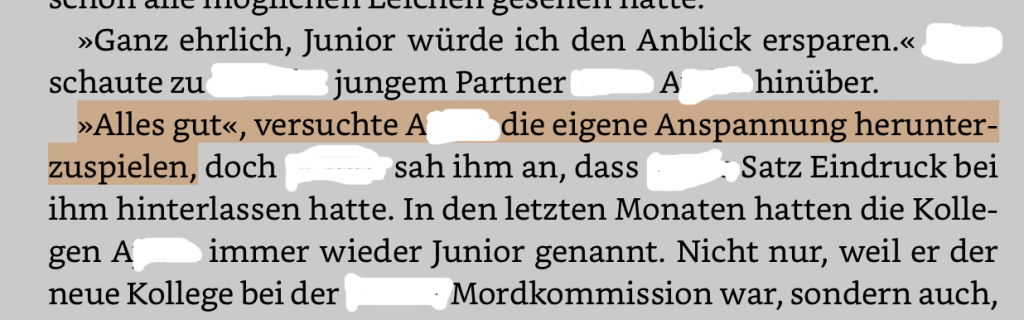 Wie immer, wenn ich Beispiele aus Büchern zitiere, mache ich Namen unkenntlich, Namen im Buch, Namen des Autors, den Titel sowieso. Ist einfach fair. Hier lesen Sie einen Auszug eines Buchs, das bei Amazon auf einem der ersten einhundert Plätze rangiert – und damit ein großer Erfolg ist.
Wie immer, wenn ich Beispiele aus Büchern zitiere, mache ich Namen unkenntlich, Namen im Buch, Namen des Autors, den Titel sowieso. Ist einfach fair. Hier lesen Sie einen Auszug eines Buchs, das bei Amazon auf einem der ersten einhundert Plätze rangiert – und damit ein großer Erfolg ist.
Es geht mir um den Satz nach „Alles gut.“ Alles gut ist ein Zitat. Jemand spricht etwas. Und dann? Dann vertraut der Autor dem Satz nicht. Denn er erklärt im Nachgang, was das Zitat zu bedeuten hat: … versuchte A. die eigene Anspannung herunterzspielen, doch XX sah ihm an, dass XXs Satz Eindruck bei ihm hinterlassen hatte. Derlei Nachgänge nennt man Inquits (für Lateinisch: inquit, er–sie–es sagte). Und die Theorie, die schriftstellerische, die schreiberische, die sehr strenge sagt, dass jeder Nachgang zu einem Zitat, der weiter geht als ein … sagte er … er antwortete … er brüllte … er meinte … unprofessionell sei.
Ich bin dieser Meinung ebenfalls. Ich kille Inquits mit großer Freude. Meist sind die ersatzlos zu streichen. Meist sind sie Humbug. Vor allem aber drücken sie eines aus: Der Autor ist seiner Sprache unsicher. Seines Ausdrucks. Er meint, immer erklären zu müssen, was schon gesagt worden ist – oder aus dem Kontext hervorgeht. Klartext: Wenn eine wörtliche Rede eines langen Inquits bedarf, schreibe man die wörtliche Rede um, bitte!
Beispiele gefällig? Kein Problem, da heute eliminiert.
(1) „Was willst du, Robby?“, bohrte sie intensiver nach, um den Grund seines Auftauchens zu erfahren.
(2) „Willst du mir nicht sagen, was du hier machst? Oder kannst du es nicht?“, forderte sie ihn mit hohl klingender Stimme auf, endlich mit der Sprache herauszurücken.
(3) „Was ist mit Dr. Ohl? Welche Rolle spielt sie?“, wiederholte er zerknirscht die Frage, die ihm unter den Nägeln brannte.
